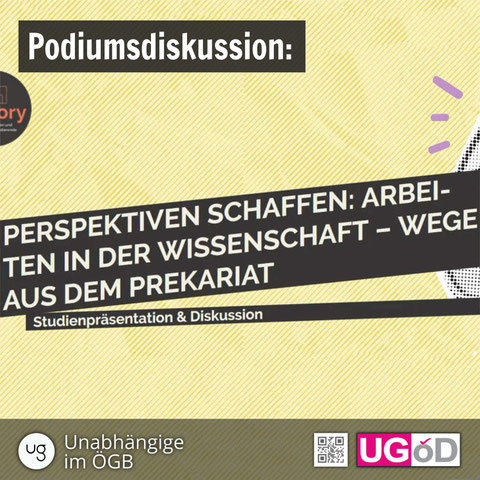Podiumsdiskussion: Prekärer Arbeitsalltag an den Universitäten
Eine Veranstaltung in Kooperation von Arbeiterkammer Wien und ÖGB-Verlag vom 3. April 2025
Podiumsdiskussion:
Arbeiten in der Wissenschaft - Perspektiven schaffen
mit
Maria John
Studienvertretung Doktorat der BOKU Wien
Wolfgang Kozak
Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer Wien
Gerda Müller
Vorsitzende des Dachverbands der Universitäten; Vizerektorin für Organisationsentwicklung, Gender & Diversity, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Vera Pfanzagl
Vertreterin des Elise Richter-Netzwerks
Moderation: Mario Keller
NUWiss - Netzwerk Unterbau Wissenschaft
Mit Prekariat verbinden wir reflexartig die Situation der Beschäftigten in den Branchen der Paketzustellung, des Tourismus, am „Bau“ und dergleichen. Hier aber reden wir von höchstqualifiziertem Personal an Universitäten, das sind immerhin mehr als 45.000 Personen aus der Gruppe des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Österreichs Universitäten. Der Anteil von befristet, prekär Beschäftigten daraus beträgt sage und schreibe 80%. Wie kann es sein, dass Österreich aus dem Kreis höchstqualifizierter Expert:innen ernsthaft davon überzeugt ist, 80% dieser Personen aus ihren Tätigkeiten in Forschung und forschungsgeleiteter Lehre per Gesetz nach sechs Jahren kaltschnäuzig aus dem Arbeitsverhältnis entfernen zu müssen? Repräsentativ für diese qualifiziert benachteiligte absolute Mehrheit legen zwei betroffene Personen auf dem Podium Zeugnis ab: Von ihren rasch abgezählten Jahren der Hoffnung auf pures Glück, dem Abwägen zwischen Familie und Karriere, bis sie schließlich – apropos – bemerken, dass sie sich in einer Lose-Lose-Lose-Situation befinden, weil ihre hochqualifizierte Tätigkeit arbeitsrechtlich keinen Sinn macht: Fallfrist – Ende des Arbeitsvertrags. Punkt.
Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, folgt der theoretische Problemaufriss. Liegt es an der Unterfinanzierung der Universitäten, obwohl die Rektorate momentan eigentlich ganz zufrieden sind? Wenig Geld sei „keine Rechtfertigung für Befristungen“, erklärt uns Arbeitsrechtler Wolfgang Kozak, vielmehr liege eine Tragik der gesetzlichen Regelung vor, und zwar von jener Dimension, die der Verfassungsgerichtshof 1990 in seinem „Denksporterkenntnis“ für geeignet hielt, eine gesetzliche Regelung als verfassungswidrig aufzuheben. Dass Kozak jedoch andererseits meint, dass die Aufhebung dieser „tragischen“ Gesetzesregelung Chaos erzeugen würde, gehört zu eben jenen spannenden Widersprüchen, die solchen Veranstaltungen zwangsläufig innewohnen. Die fürs Publikum zentrale Frage nach rechtlichen Chancen vor Gericht, bleibt letztlich mit dem Hinweis auf „Einzelfallrecht“ sehr unbefriedigend.
Den Vorstoß über die Denksportgrenzen hinweg wagt Stephan Pühringer, Sozioökonom an der Universität Linz, mit seiner Kritik an fehlender Beschäftigungskultur, mangelnden Planungshorizonten, dem Festhalten am Dogma der Wettbewerbsindikatoren und zunehmender Individualisierung. Dann brauche man nämlich keine Unis mehr.
Gerda Müller, die als Dachverbandsvorsitzende und Vizerektorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien für die Seite der Arbeitgeberinnen eingeladen wurde, stellt eingangs fest, dass ihre Uni nicht als Präzedenzfall herhalten kann, weil diese atypisch relativ viele Professor:innen im Verhältnis zu Senior Lecturern und -Artists, sowie Lektor:innen beschäftigt, dazwischen allerdings fast „nichts“, weil es kaum Laufbahnstellen an Kunstuniversitäten gibt. Dafür gibt es ein gegenüber der übrigen Universitätslandschaft vergleichsweise vorbildliches Entfristungssystem für prekär beschäftigte Lektor:innen. Aufhorchen lässt insbesondere ein Einblick in die menschliche Dimension der Belastung von Universitätsleitungen im Falle von Bedarf nach Kündigungen, vor allem wenn solche budgetär motiviert sind. Unzweifelhaft ist das eines der Motive für die von Rektoraten immer wieder eingeforderte Notwendigkeit für ein Sonderarbeitsrecht mit – im Vergleich zur Privatwirtschaft – ausgedehnten Befristungsmöglichkeiten. Ein Ausblick für die Zukunft aus Sicht von Gerda Müller? Entwicklungsprogramme und Sozialpartnerschaft. Das lässt zumindest hoffen.
Wissenschaftliche Grundlage für das Diskussionsthema lieferte die Studie „The Employment Situation of the Mittelbau at Austrian Universities“, die von der Mitautorin Julia Partheymüller eingangs in stringenter Dichte und dennoch detailreich präsentiert wurde.
Wir sind mittlerweile den hohen Qualitätslevel des (weiteren) Kooperationspartners „NUWiss - Netzwerk Unterbau Wissenschaft“ schon gewohnt. Er stellt die Grundlage dafür dar, das darzulegen, was Sache ist. Und diese Darlegung gelingt in der erwähnten Studie bemerkenswert repräsentativ und damit glaubwürdig, flankiert vom Engagement vieler Beschäftigter an Österreichs Universitäten.
Aufzeichnung der Podiumsdiskussion:
https://www.youtube.com/live/gWepdKlMtp4?si=ZSel7cw3U_T7h5BH
Stefan Schön
Pressesprecher der UGÖD
Stellv. Vorsitzender der Bundesleitung 13 (Universitätsgewerkschaft) der GÖD